

Bellizismus eindämmen
Als liebender Vater denke ich oft über die Zukunft nach. Welche Welt werden die Generationen nach uns übernehmen, frage ich mich dann.
Der nächste Gedanke ist, ob wie genug dafür getan haben, eine lebenswerte Welt zu übergeben.

Politisch denken
Willy Brandt hat einmal gesagt, dass das die beste Art ist, die Zukunft vorher zu sagen, sie eben auch zu gestalten. So sehe ich das auch. Ich fühle neben den ganzen lautstarken Brandstiftern, auch immer noch den Geist von Willy Brandt in unserer Gesellschaft.
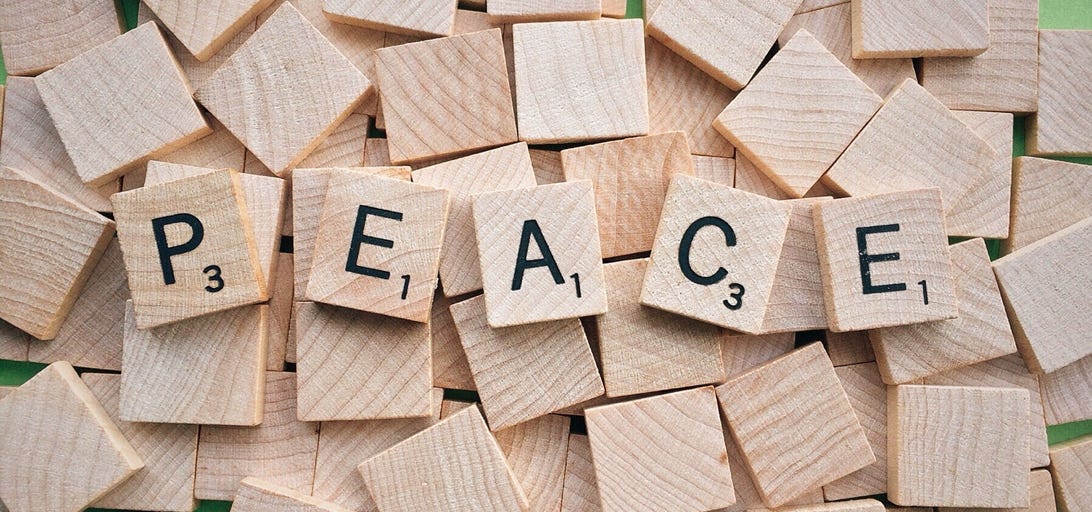
Beispiele geben
Die aktuelle Politik zeigt wenig Mut, vor allem Bedenken, Kontrolle und Angst…
Sitzen wir bald alle in einem Boot?
Verständigung, Kommunikation und Nachhaltigkeit sind so wichtig für die Welt von Morgen…

Wenn es stimmt, dass die westlichen Eliten den Anschlag nicht nur billigend in Kauf nahmen, sondern ihn womöglich als willkommenes Fanal der „Zeitenwende“ interpretierten, dann wäre die offizielle Geschichtsschreibung der letzten drei Jahre zu revidieren. Die Mär von der friedliebenden Bundesrepublik, die durch Putins Aggression aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt wurde, bekäme Risse – und die Frage nach der viel beschworenen Souveränität Deutschlands müsste neu gestellt werden.
Am 15. November 2022 schien für einige Stunden das Unaussprechliche zum Greifen nah: Eine Rakete schlägt auf polnischem Boden ein, zwei Menschen sterben, und sofort wird die NATO in Atemnot versetzt. „Russland hat Polen angegriffen!“ – so die erste Schlagzeile, so die erste Deutung, so das eingespielte Drehbuch. Artikel 5 klopfte schon hörbar an die Tür, und Washington wie Warschau hielten die Luft an.
Doch dann die Wendung: Die Trümmer stammten nicht aus Putins Arsenal, sondern aus einer ukrainischen Flugabwehrrakete des Typs S-300. Fehlgeleitet beim Versuch, russische Raketen abzufangen, krachte sie in das Dorf Przewodów. Ein tragisches Unglück, zweifellos – aber eben kein „russischer Angriff auf NATO-Gebiet“.
Die Lehre? Einmal mehr, wie reibungslos der Reflex funktioniert, Moskau als Quelle allen Übels auszurufen – und wie gefährlich diese automatische Zuschreibung sein kann. Denn wenige Stunden lang stand die Welt am Rand einer Eskalation, deren Folgen niemand übersehen konnte. Dass die Korrektur, als die Beweise eindeutig waren, dann nur noch im Kleingedruckten nachreichte, gehört zum Standard westlicher Kriegsberichterstattung: Schlagzeile groß, Dementi klein.
Für Kiew wiederum war der Vorfall heikel. Selenskyj bestritt noch tagelang, dass es eine ukrainische Rakete gewesen sei – in der Hoffnung, den moralischen Hochsitz nicht zu verlieren. Die NATO dagegen winkte das „Missverständnis“ mit väterlichem Lächeln durch. Denn was nicht sein darf – dass der tapfere Verteidiger versehentlich die Allianz ins Chaos reißt – das kann nicht sein.
Und so bleibt das Dorf Przewodów ein Symbol dafür, wie dünn der Firnis zwischen „Zeitenwende“ und Weltenbrand ist. Eine einzige Rakete, falsch geflogen, und der Westen stand kurz davor, sich in die nächste Stufe der Eskalation hineinzureden.
Im März 2022, ein halbes Jahr vor dem Nordstream-Anschlag und kaum vier Wochen nach dem russischen Überfall, saßen in Istanbul Unterhändler aus Moskau und Kiew am Tisch. Von „Neutralität“ der Ukraine war die Rede, von Sicherheitsgarantien durch Drittstaaten, von einem denkbaren Rückzug russischer Truppen. Für einen Moment schien die Logik der Waffen schweigen zu müssen – die Diplomatie wagte einen zarten Anlauf.
Dann kam Boris Johnson. Der britische Premier, der sonst eher durch Parties im Lockdown und schlecht sitzende Anzüge auffiel, eilte im April nach Kiew und erklärte Selenskyj, dass der Westen hinter ihm stehe, „solange es dauert“ – und dass es daher besser sei, weiterzukämpfen, statt auf ein unsicheres Abkommen mit Putin zu setzen. So zumindest berichteten es ukrainische Medien wie Ukrainska Pravda.
Die Botschaft war unmissverständlich: Ein schneller Frieden, womöglich noch unter Preisgabe ukrainischer Gebiete, passte nicht ins geopolitische Konzept. In Washington wie in London setzte man auf „strategische Abnutzung“ Russlands – und da störte ein ukrainisch-russischer Kompromiss nur. Johnson spielte den Lautsprecher dieser Linie, mit britischem Zynismus und der Gewissheit, dass man selbst keine Bomben auf London fürchten musste.
Ob Selenskyj tatsächlich ohne Johnson unterschrieben hätte, bleibt Spekulation. Doch dass der britische Premier die Verhandlungsbereitschaft nicht gerade stärkte, sondern sie demonstrativ unterlief, ist schwer zu bestreiten. Was als „Solidaritätsbesuch“ verkauft wurde, war in Wahrheit die klare Ansage: Keine Deals mit dem Kreml.
Und so wurden aus den Gesprächen von Istanbul Fußnoten der Geschichte. Aus einer möglichen Waffenruhe wurde ein Stellungskrieg, aus Verhandlungen ein Dauerbombardement. Millionen Ukrainer flohen, Zehntausende starben, ganze Städte wurden zertrümmert – doch die „westliche Geschlossenheit“ hatte gesiegt.
Vielleicht wird man irgendwann schreiben, dass der Krieg im Frühjahr 2022 an einem Hotel in Istanbul hätte enden können. Stattdessen endete dort nur der Versuch, den Frieden zu wagen – hintertrieben nicht von russischen Generälen, sondern von einem britischen Premier, der lieber Weltgeschichte spielen wollte, als leere Champagnerflaschen im Downing Street Keller zu zählen.
Man stelle sich die Szene vor: Anchorage, Alaska, immer irgendwie Winter. Schneidender Wind, eine Bühne, die für das Groteske wie geschaffen scheint. Auf der einen Seite Wladimir Putin, der seine Krim im Rucksack und den Krieg im Nacken trägt. Auf der anderen Donald J. Trump, Immobilienhai, Wahlkämpfer, Egomane. Beide sitzen nicht in einem Verhandlungszimmer, sondern in einem Showroom: Es geht nicht um Geschichte, sondern um das Geschäft. Wie damals, als die Russen lieber den Amerikanern Alaska „vertickten“ statt es an England zu verlieren…
Für Trump ist der Krieg in der Ukraine kein Drama von Freiheit und Tyrannei, sondern ein „bad deal“. Er kostet die USA Milliarden, bringt aber nichts ein. Seine Wähler wollen keine Werte exportieren, sondern billiges Benzin. Warum also nicht, wie schon bei Bankrotteuren und Bauunternehmern in Manhattan, mit Putin einen „deal“ machen?
Trump würde Putin nicht mit moralischen Tiraden kommen. Er würde ihm die Kalkulation auf den Tisch legen: „Du willst die Krim und ein paar Städte im Donbass? Nimm sie. Dafür hörst du auf zu schießen, ich lockere ein paar Sanktionen, und wir verkaufen das der Welt als Frieden. Deal.“ Selenskyj bekäme das Trump’sche Standardangebot: „Take it or leave it.“ Die Ukraine würde zur Variablen in einem Immobilienvertrag, nicht zur souveränen Nation.
Und Europa? Ursula von der Leyen könnte ihre Sonntagsreden über Werte in die Schublade legen. Friedrich Merz, der eben noch vom „deutschen Führungsanspruch im Westen“ schwadronierte, müsste mitansehen, wie der Krieg ohne deutsche „Zeitenwende“ beendet wird – durch einen Geschäftsmann im Baseballcap, der sich für klüger hält als alle Diplomaten der EU zusammen. Merz käme politisch einfach wie immer zu spät: eben der zweite-Wahl-Kanzler.
Natürlich wäre der Preis hoch: eine territorial verstümmelte Ukraine, ein Putin, der in den Geschichtsbüchern als Sieger steht, eine internationale Ordnung, die endgültig zur Lachnummer verkommt. Aber Trump bekäme den Triumph, den er will: „Only I could stop World War III.“ Und die Bilder wären unbezahlbar: Trump und Putin, Schulter an Schulter in Anchorage, zwei Männer, die den Frieden „machen“, als sei er ein Golfresort.
So zynisch das klingt: Genau diese Logik könnte funktionieren. Nicht Werte, nicht Moral, nicht Zeitenwende – sondern Geschäft. Vielleicht wird der Krieg nicht durch Staatsmänner beendet, sondern durch einen Immobilienhai, der den Frieden wie ein Hotelprojekt kalkuliert: schmutzig, halbgar, aber besser als Dauerbombardement.
Und vielleicht ist genau das der bittere Witz unserer Epoche: Dass ein Trump, den die westlichen Eliten für den Totengräber der Demokratie halten, am Ende der Einzige sein könnte, der einen Waffenstillstand zustande bringt. Nicht weil er an Frieden glaubt, sondern weil er glaubt, dass er am meisten davon hat. Und beim Golf…? Da konnte man deutlich sehen, schummelt der amerikanische Präsident…

Copyright brain4net.de © 19.04.2025
On peut résister à l’invasion d'une armée mais pas à celle d’une idée dont le temps est venu. Victor Hugo
Diese Website verwendet Cookies. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung für Details.
OK